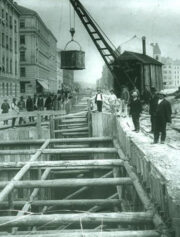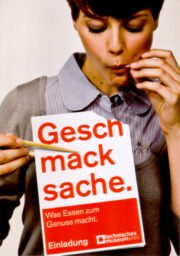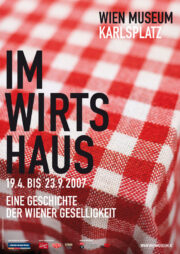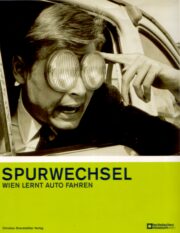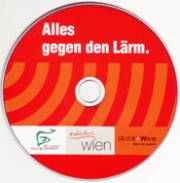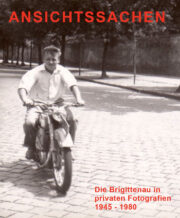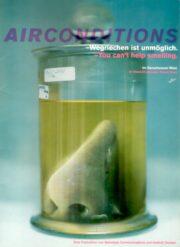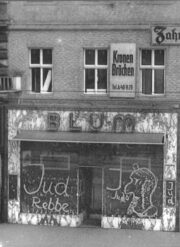Der Wert des Bargeldes
Technisches Museum Wien, 2024-2025
(Co-Kurator)
Österreich gehört zu jenen Ländern, in denen die Nutzung von Bargeld (noch) weit verbreitet ist. Heftige politische Diskussionen wurden und werden darüber geführt, dass dies auch so bleibt. Die Ausstellung geht den sozialen, kulturellen und technischen Aspekten des analogen Bezahlens nach. Im Mittelpunkt stehen die Materialität und sinnliche Beschaffenheit von Geld. Wie klingt und riecht es? Wie fühlt es sich an? Wie produzieren und erhalten wir es? Leitobjekt dazu ist der Bankomat, mit dem sich jederzeit, schnell und kostenlos Bargeld ziehen lässt. In Wien wurde er erstmals im Jahr 1980 aufgestellt. Seine Geschichte ist eng mit der Stadt und dem beginnenden Computerzeitalter verbunden.